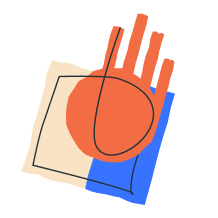Diese seltsame Leere
Schaue ich abends in den Spiegel, so erkenne ich immer wieder diese seltsame Leere. Sie zu beschreiben fällt mir schwer – schließlich ist da nichts in jenen Momenten. Sie stülpt sich ungefragt nach außen. Zeigt, was da nicht ist. Was…