Wir reden ständig. Erzählen von unseren Erfahrungen. Teilen ungefragt unsere Meinung und geben Tipps, wie alles besser sein könnte. Bleiben an der Oberfläche. Weil es einfacher ist. Ursache und Wirkung. Problem und Lösung.
In dieser zweiteiligen Serie schreibe ich über meine Veränderung. Über das Verstehen von Mustern und Anpassen der eigenen Haltung. Psychoanalyse brachte mir Zugewandtheit und Ruhe. Empfinde mich als interessierter. Möchte aber noch besser verstehen, was in Menschen und Teams passiert. Unbewusste Muster und Übertragungen aufdecken. Einen Perspektivwechsel anstoßen, der nicht direkt Lösungen in den Vordergrund stellt. Verständnis statt Handlungszwang.
Muss verstehen, wie sich Situationen begleiten lassen. Bessere Fragen stellen. Den Raum halten. Durchatmen – was in der schnelllebigen Produktentwicklung selten passiert. Dort werden Prozesse optimiert, Ideen skaliert. Beziehungen lassen sich aber nicht beliebig skalieren. Wir sind Teil komplexer Systeme. Regeln verbinden uns miteinander. Grenzen schaffen Hierarchien. Erwartungen prägen Verhalten.
Systemisch-psychologisches Coaching hilft als Form gleichberechtigter Zusammenarbeit. Es erweitert Perspektiven. Macht Umstände greifbarer. Akzeptiert jede Persönlichkeit als einzigartig.
Coaching? Puh.
Der Begriff Coaching schreckte mich ab. LinkedIn wird dazu beigetragen haben. Postkartensprüche und ein fehlender Standard. Meine Therapie hat mir gelehrt, dass Veränderung Zeit braucht. Und ein Studium der Psychologie. Und tausende Stunden an Praxis. Bis Freunde von ihrem Coach erzählten. Ich war skeptisch. Und doch neugierig.
Mit den Wochen veränderte sich ihr Umgang miteinander. Zugewandter. Rücksichtsvoller. Sie schwärmten von den Terminen. Waren interessierter. Aneinander. An mir. Irgendwann begannen sie eine Ausbildung. Blieben in ihren alten Jobs. Wurden keine Business Coaches. Keine Masterclass und auch kein Retreat.
Ich wollte das auch. Wollte verstehen, wie Beziehungen funktionieren. Welche Werkzeuge Systeme besprechbar machen. Also begann ich eine Ausbildung am Hamburger Institut für systemische Lösungen.
Systemisch-psychologische Beratung.
Die systemisch-psychologische Lehre geht davon aus, dass Menschen in Beziehungen leben. In Systemen. Familie. Beruf. Freundeskreis. Probleme sind nie isoliert. Sie entstehen dazwischen. In den Wechselwirkungen.
Ziel ist es, die Komplexität der realen Welt zu verstehen. Sichtbar zu machen. Gemeinsam vorhandene Ressourcen zu identifizieren und Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, um Lösungen zu finden. Dabei arbeiten Coach und Klient:in zusammen.
Als Coach verantworte ich den Prozess. Halte den Raum und das Ziel im Blick. Neutrale Position. Angstfrei. Auf Augenhöhe. Dazu stelle ich vor allem Fragen. Zirkuläre Fragen, die dazu anregen, die Perspektive zu wechseln und dabei Muster zu erkennen. Es geht nicht um das „Warum?“ – dafür um „Was funktioniert?“, „Wie?“ und „Womit?“
Die systemisch-psychologische Beratung hat Grenzen. Sie ist keine Behandlung im medizinischen Sinne. Keine Diagnosen. Keine Heilungsversprechen. Es geht um Gestaltungskompetenz. Um Wahlfreiheit. Um eigene Ressourcen. Selbstklärung statt Fremdbestimmung.
Menschen und Beziehungen.
Meine Therapie fragte nach dem Warum. Vergangenheit. Ursachen. Die systemische Ausbildung verändert meinen Blick. Auf die Gegenwart. Im Zentrum steht die Idee des Konstruktivismus: Es gibt nicht die eine Wahrheit. Jeder konstruiert seine Wirklichkeit. Das verunsicherte mich. Wird mir doch überall gesagt, was stimmt. Welches Lager richtig ist. Freund oder Feind. Lässt man jedoch unterschiedliche Ansichten zu, schafft dies einen Möglichkeitsraum.
In diesem Raum sind wir keine Einzelkämpfer. Wir stehen in Wechselwirkung.Alles wirkt auf andere. Und umgekehrt. Keine linearen Ketten. Sondern Kreisläufe. Rückkopplungen. Nicht der Sender bestimmt die Wirkung einer Botschaft. Sondern der Empfänger. Was ich sage und was ankommt, sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Diese Erkenntnis verändert meine Art der Zusammenarbeit.Statt Lösungen zu kennen: Perspektiven wechseln. Statt Fehler suchen: Neugierig sein. Auf Unterschiede. Auf Wahrnehmungen. Nicht Experte. Sondern Komplize.
Denn oft hat alles eine Bedeutung. Jedes Verhalten hat einen verborgenen Sinn oder einen Nutzen für das System. Jedes Element folgt einem „Wofür?“. Dieses Wofür erfüllt eine wichtige Funktion, denn es beschreibt das Ziel und deckt die Logik eines Systems auf.
Beispiel: Ein Produktteam ignoriert User Research. Obwohl es gute Gründe gibt, sie einzubinden. Die gewohnte Frage nach dem „Warum?“ sucht Ursachen. Schuld. Fehler. Führt zu Rechtfertigungen. Oder Anklagen. „Wofür?“ sucht die Funktion in der Gegenwart. Das Ignorieren der Unterstützung ist das Symptom. Vielleicht schützt sich das System aber vor Überforderung, Kontrollverlust und dem Verlust des Expertenstatus.
Unser Ziel könnte sein, dieses Wofür zu erkunden, statt das Problem schnell weg machen zu wollen. Verstehen statt lösen. Nicht Perfektion, sondern gemeinsames Verständnis entwickeln. Vermitteln und gemeinsames Erkunden.
Drei Modelle zum bewussten Erkunden möchte ich mit euch teilen:
Das Innere Team
Fast alle Teamkonflikte oder Innovationsstaus sind keine Fehler von Einzelnen, sondern das Ergebnis eingespielter Interaktionsmuster. Ähnlich verhält es sich mit unseren inneren Konflikten: Oft fühlen wir uns zerrissen, weil verschiedene innere Anteile in uns streiten. Das Modell des „Inneren Teams“ macht diese Dynamik sichtbar.
Beispiel: Ihr wollt eine große Produktentscheidung treffen. Die „innovative Visionärin“ jubelt. Der „sicherheitsorientierte Analyst“ warnt vor Risiken. Der „Harmoniebedürftige“ scheut den Konflikt mit der Entwicklung. Diese inneren Stimmen blockieren.
Das Modell hilft uns, Zerrissenheit zu verstehen. Unterschiedliche Stimmen wertzuschätzen und zu moderieren. Unsere Aufgabe ist es dann, diese verschiedenen Anteile wie ein guter Teamkapitän zu einer gemeinsamen, tragfähigen Entscheidung zu führen.
Der Teufelskreis
Wenn im Team etwas schiefläuft, suchen wir oft instinktiv nach einem Schuldigen. Die systemische Sichtweise schlägt eine andere Perspektive vor: Was, wenn das Problem gar nicht bei einer Person liegt, sondern im Muster dazwischen? Genau hier setzt das Modell der „Teufelskreise“ an.
Beispiel: Das Sales-Team fühlt sich vom Produktteam ignoriert und übt deshalb immer mehr Druck aus, um endlich gehört zu werden. Das Produktteam fühlt sich von diesem Druck überfallen, empfindet die Forderungen als unrealistisch und zieht sich noch weiter zurück. Das wiederum frustriert das Sales-Team, das den Druck weiter erhöht. Niemand ist „schuld“ – beide Seiten stecken in einem Muster fest, das die Situation Runde für Runde verschlimmert.
Das Teufelskreis-Modell hilft uns im Produktmanagement, diese unsichtbaren Dynamiken zu visualisieren. Statt uns zu fragen „Wer hat angefangen?“, können wir die gesamte Schleife visualisieren. Allein das Erkennen des gemeinsamen Kreislaufs entlastet. Nimmt die persönliche Schuld aus dem Konflikt. Es kann geziehlt nach einem Ausstieg gesucht werden. Meist durch kleine Kommunikations-Änderungen.
Werte und Entwicklungsquadrat
Manchmal entstehen Probleme nicht aus Schwächen. Sondern aus übertriebenen Stärken. Das „Werte- und Entwicklungsquadrat“ macht das sichtbar. Jeder positive Wert hat eine dunkle Seite. Eine entwertende Übertreibung.
Beispiel: Ein Team legt großen Wert auf Schnelligkeit (ein positiver Wert). Wird diese Schnelligkeit aber übertrieben, schlägt sie in Flüchtigkeit um (die Übertreibung). Der positive Gegenpol zur Schnelligkeit ist die Sorgfalt. Wird diese aber übertrieben, führt sie zu lähmendem Perfektionismus. Der Konflikt im Team ist oft nicht Schnelligkeit vs. Sorgfalt, sondern Flüchtigkeit vs. Perfektionismus.
Das Werte- und Entwicklungsquadrat veranschaulicht Wertediskussionen im Team. Es hilft zu erkennen, dass oft nicht zwei gegensätzliche Positionen aufeinanderprallen, sondern dass beide Seiten eine positive Absicht haben. Das Quadrat verwandelt einen „Entweder-Oder“-Konflikt in eine konstruktive „Sowohl-Als-Auch“-Entwicklung.

Diese drei Werkzeuge teilen grundlegende Gemeinsamkeiten. Keine schnellen Lösungen. Eher Kompasse. Helfen beim Fokus-Wechsel. Weg von Schuldfrage. Hin zur Mustererkennung. Machen unsichtbare Dynamiken sichtbar. Im Inneren Team und im echten Team. Dieses Verstehen ist die Voraussetzung, um aus festgefahrenen Kreisläufen auszusteigen. Für bewusste, konstruktive Schritte.
Fazit: Menschen für Menschen.
Ihr versteht nun vielleicht, warum ich meine Psychoanalyse und die systemisch-psychologische Ausbildung als so wertvoll betrachte. Wie sie mich verändert haben. Und meine Arbeit beeinflussen.
Ich sehe mich viel seltener als Experte oder Berater. Ich verstehe mich als Komplize. Zugewandt Neugierig. Auf Augenhöhe.
Als Produktmenschen können wir einiges ausprobieren:
- Die Macht unbewusster Muster. Nicht nur zuhören, was Nutzer:innen sagen, sondern aufmerksam beobachten, was sie tun. Und im Team akzeptieren, dass eine Diskussion oft ein Symptom für einen tieferen Konflikt ist. Zum Beispiel um Anerkennung oder Sicherheit.
- Den Raum halten, statt ihn mit Lösungen zu fluten. Als Produktmenschen stehen wir unter konstantem Druck, Antworten zu liefern. Eine zugewandte Haltung ermöglicht uns, die Unsicherheit im Problemraum länger auszuhalten. Dem Team Zeit für echtes Verständnis zu geben und nicht auf die erstbeste Lösungsidee anzuspringen.
- Beziehungen als das eigentliche Betriebssystem sehen. Unsere wichtigste Aufgabe ist nicht das Managen von Backlogs, sondern das Gestalten von Kommunikation.
- Akzeptieren, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Unsere Aufgabe ist nicht, den einen „richtigen“ Weg zu finden, sondern die verschiedenen Wahrheiten zu einer gemeinsamen Strategie zu integrieren.
- In Kreisläufen denken, nicht in geraden Linien. Ein Problem ist kein isoliertes Ereignis, sondern oft das Ergebnis eines eingespielten Prozesses. Ein Feature-Wunsch ist Teil eines größeren Nutzungskontextes.
- Neugierig auf Wechselwirkungen sein. „Was passiert hier gerade zwischen uns? Welches Muster erzeugen wir gemeinsam?“ Das verlagert den Fokus von der Person auf die Dynamik und eröffnet konstruktive Lösungswege.
Ich habe das Gefühl, unsere Branche konzentriert sich zu sehr auf technische Entwicklungen, betriebswirtschaftliche Dynamiken und den nächsten großen Trend. Wir optimieren Prozesse, implementieren Tools und analysieren Daten. Wir beschäftigen uns mit Technologie.
Aber setze ich mich mit den Erkenntnissen der letzten Jahre auseinander und versuche die Beobachtungen in meinem Umfeld zu verstehen, so werde ich immer überzeugter: Wir müssen uns wieder mehr mit den Menschen und ihren Verhaltensmustern beschäftigen.
Damit wir den Kern nicht aus den Augen verlieren: Menschen entwickeln Produkte für Menschen. Das braucht einen Blick unter die Oberfläche, das Aushalten von Unsicherheit, das ehrliche Interesse an den Mustern hinter dem Verhalten.
Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle zu Therapeut:innen werden. Oder Coaches. Es geht mir darum, in unserer Arbeit zugewandter zu sein. Nachsichtiger. Am Ende vielleicht einfach nur menschlicher. Die besten Produkte entstehen nicht aus besten Prozessen. Sondern aus tiefstem Verständnis für Menschen. Das geht nur mit ehrlicher Neugier. Und Offenheit fürs Stolpern.
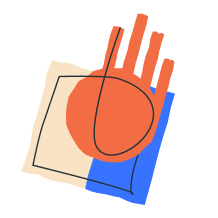
[…] Wir reden ständig. Geben ungefragt Tipps. Hören nur selten aufmerksam zu. Bleiben lieber an der Oberfläche. Schade. Sind wir doch alle Teile von komplexen, eingespielten Systemen. Wie wertvoll Perspektivwechsel sind, lernte ich in meiner systemisch-psychologischen Ausbildung. […]
[…] Artikel über Produktstrategie für neue Medienorganisationen und Modelle aus Psychoanalyse und systemischer Beratung im Produktmanagement. Habe meine Webseite komplett überarbeitet und eine Marke angemeldet. War auf […]