Ich kann nicht mehr. Das wird mir alles zu viel. Keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. In fast jedem Gespräch spüre ich momentan eine Form der Unzufriedenheit. Der Erschöpfung. Vom Optimieren, Reagieren und Präsentieren.
In dieser zweiteiligen Serie werde ich darüber schreiben, was mir in den letzten Jahren geholfen hat, Stimmigkeit zu finden und so meine Arbeit als Produktmensch zu verbessern: Psychoanalyse und systemisch-psychologische Beratung. Habe mich so viel mit Menschen und ihren Mustern beschäftigt. Habe verstanden, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Kann ruhiger mit der hohen Geschwindigkeit umgehen und Menschen auf Augenhöhe begegnen. Kann Bedürfnisse zugewandter begreifen. Bin interessierter. Und auch ein ganzes Stückchen zufriedener.
Meine These: Wir müssen uns mehr mit Menschen beschäftigen. Wir sollten verstehen, was in uns passiert. Und wie wir in den Systemen um uns herum agieren. Denn am Ende entwickeln Menschen Produkte für Menschen.
Ein System unter Druck.
Spreche ich mit Menschen, spüre ich eine enorme Überforderung und mentale Belastung. Irgendwie verständlich. Die Komplexität, die Geschwindigkeit und die Unsicherheit in unserer Arbeit und unserem Umfeld wachsen. Kaum haben wir uns an eine Krise gewöhnt, kommt die nächste. Dazu eine Flut an Informationen, ständige Erreichbarkeit, immer neue Tools und Methoden. Das „System Mensch“ scheint überlastet. Emotional unter Druck. Können nicht mehr. Wollen nicht mehr. Organisationen spüren das direkt. Berichten von Unruhen. Dem ständigen Druck, sich zu verändern und abzuliefern.
Was passiert? Eine fast zwanghafte Fokussierung auf schnelle Lösungen und heilsame Frameworks. Auf jede Unsicherheit antworten wir mit einem neuen Prozess, einem neuen Tool, einem neuen „Quick Win“. Wir springen direkt in die Handlung. Optimieren und automatisieren. KI liefert uns jetzt noch schneller Anstöße und scheinbare Lösungen. Und dieses Tempo verschärft eine Oberflächlichkeit.
Spüre immer häufiger Identitäts- und Sinnfragen bei Einzelpersonen. Wer bin ich eigentlich in diesem System? Wie reagiere ich auf die Erwartungen meines Umfelds. Und wie auf die Veränderungen in der Gesellschaft? Eine ständige Sinnsuche. Innere Zerrissenheit und Unsicherheit nehmen zu. Hab das Gefühl, wir verlernen uns selbst und einander zuzuhören. Stimmen zu laut. Lärm zu groß.
Sind Menschen unter Druck, dann sind es auch die Organisationen, in denen sie arbeiten. Dabei müssen diese immer mehr schaffen. Teams sind crossfunktional über Landesgrenzen hinweg aufgestellt. Design, Entwicklung, Produkt: jede dieser Professionen hat ihre eigene Sprache, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigene Kultur. Wir arbeiten für das System, indem wir uns in internen Machtkämpfen verlieren oder Metriken optimieren, die nur intern relevant sind. Statt die (unbewussten) Bedürfnisse unserer Kund:innen zu adressieren. Wir reagieren übereilt. Der schnelle Wechsel von Krise zu Krise, von Tool zu Tool, gefährdet Gemeinschaft, Sinn und am Ende auch die Qualität unserer Arbeit. Wir rennen und rennen und rennen.
Dieser Sprint zehrt an den Kräften. Diese Menge an Themen überfordert. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Hatte selbst ein intensives Kapitel, das mich nicht schlafen ließ. Bin immer wieder mit Menschen aneinandergeraten. Ich war unzufrieden mit mir und meinen Ergebnissen. Antriebslos. Genervt. Leer.
Hab mich ständig gefragt, wie ich dieses Problem loswerde. Hab Bücher gelesen, Selbsthilfe-Artikel verschlungen, Tagebuch geschrieben und Strukturen in meinem Alltag angepasst. Hab mich im Kreis gedreht und unfassbar viel Energie verbrannt.
Dann ging nicht mehr viel. Ich brauchte Hilfe. Wollte verstehen, woher dieses Gefühl der Überforderung kam und wie es wieder weggeht. Und so begann ich eine Analytische Psychotherapie. Also ab auf die Couch.
Analytische Psychotherapie.
Die Analytische Psychotherapie ist ein Verfahren, das auf der Psychoanalyse beruht. Die Grundannahme ist, dass viele unserer täglichen Probleme, unsere Muster und Konflikte, ihre Wurzeln in der eigenen Lebensgeschichte haben. In unbewussten Überzeugungen und Erfahrungen. Diese steuern unser Handeln, ohne dass wir es merken. Ziel der Therapie ist es, diese unbewussten Muster und inneren Konflikte aufzudecken und zu verarbeiten, um ein besseres Verständnis der eigenen Persönlichkeit zu gewinnen. Und so schrittweise eine Veränderungen im Erleben und Verhalten zu erreichen.
Wie lief das ab? Ein bisschen wie das Klischee aus Serien. Ich lag zweimal pro Woche für 50 Minuten auf einer Couch und habe geredet. Mit mir selbst. Gedanken ausgespeichert. Gefühle in Worte verpackt. Assoziiert. Über alles, was mir in den Sinn kam.
Und mein Therapeut? Er hat vor allem den Raum gehalten. Er hat meine Gefühle ausgehalten. Meine Wut, meine Trauer, meine Verzweiflung. Er hat mich nicht dafür verurteilt. Ich durfte klagen, ohne dass er mir sagte, ich solle mich zusammenreißen. Ich musste nicht sofort in die Lösung springen, so wie ich es gewohnt war. Es gab keinen Handlungsdruck. Er hielt einfach die Stimmung mit mir aus. War da. Nur für mich.
Und er hat Fragen gestellt. Selten Ratschläge gegeben, aber immer wieder Fragen gestellt. Fragen, die mich näher zu meinen Gefühlen führten. Das fiel mir zu Beginn der Therapie unfassbar schwer. Ich wollte Tipps und Antworten. Wollte nicht warten. Wollte nicht ständig mein eigenes Klagen hören. Wollte den nächsten Schritt oder eine Antwort darauf, wie andere Menschen diese Themen für sich lösen.
Das Ziel der Therapie war aber nicht, ein Symptom schnell zu beseitigen. Das Ziel war die bewusste Wahrnehmung von Gefühlen. Sich Zeit lassen und sich Zeit geben. Zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Aufdecken, nach welchen Mustern ich meine Entscheidungen treffe. Um im Alltag diese Muster direkt zu erkennen. Und so wieder die Kontrolle gewinnen. Eigenverantwortung übernehmen. Aber auch Nachsicht haben. Mit mir. Mit meiner Situation. Mit meiner Vergangenheit.
Ich merkte, wie sich meine Haltung veränderte. Wie ich mit mir umging. Wie ich auch meinen Kolleg:innen anders begegnete. Ich stellte mehr Fragen. Wollte begreifen. Gab uns Zeit, ohne Agenda miteinander zu sprechen. Wurde besser darin, Unsicherheiten auszuhalten. Entwickelte eine noch größere Neugier für Menschen. Und ihre Muster.
Muster erkennen: Psychoanalyse im Produktmanagement
Das Schöne an der Psychoanalyse ist: Sie ist neben Therapieform auch ein Wissensschatz über das Menschsein. In Büchern und Podcasts lerne ich Konzepte kennen. In Podcasts und Blogbeiträgen durchdinge ich Lebensgeschichten. Manches fühlt sich bekannt an. Anderes fremd. Das ist aufregend.
Drei dieser Leitplanken, die meinen Blick auf Menschen und Zusammenarbeit verändert haben, möchte ich vorstellen:
Das Unbewusste
In der Therapie lernte ich, meine eigenen wiederkehrenden Muster zu erkennen. Warum ich in bestimmten Situationen immer gleich reagiere. Das Konzept des Unbewussten erklärt das: Der größte Teil unseres Seelenlebens, unsere tiefsten Wünsche, Ängste und Motivationen, spielt sich unter der Oberfläche ab. Diese unbewussten Kräfte steuern unser Verhalten und unsere Entscheidungen, ohne dass wir es direkt merken. Das gilt für uns, aber auch für unsere Nutzer:innen und Teams.
Beispiel: Ein Nutzer fordert vehement eine neue Dashboard-Funktion mit noch mehr Kennzahlen. Das ist sein bewusster Wunsch. Hört man genau zu, stellt sich heraus, dass er sich von seinem Vorgesetzten oft kontrolliert fühlt. Sein eigentliches, unbewusstes Bedürfnis ist also nicht das Dashboard selbst, sondern das Gefühl von Sicherheit, Kontrolle und Kompetenz, um in Meetings bestehen zu können.
Haltung fürs Produktmanagement: Wir müssen graben. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, die geäußerten Wünsche aufzusammeln, sondern verstehen zu wollen, woher sie kommen. Auf der Suche nach wahren, unbewussten Treibern. Produkte, die diese tieferen Bedürfnisse ansprechen, schaffen eine viel stärkere Verbindung zu den Nutzer:innen.
Der Widerstand
Mein Therapeut sprang nur selten auf meine Klagen an. Er hielt den Raum. Hielt meine Gefühle mit mir aus und gab mir Zeit. Veränderung braucht Zeit und stößt ständig auf Widerstand. In der Psychoanalyse wird Widerstand nicht als böser Wille oder Sturheit verstanden, sondern als ein unbewusster und völlig normaler Schutzmechanismus. Er schützt eine Person oder ein ganzes System vor einer Veränderung, die als bedrohlich für die eigene Stabilität, Identität oder Sicherheit empfunden wird.
Beispiel: Ein Team soll eine neue, effizientere Arbeitsweise einführen. Obwohl alle die logischen Vorteile verstehen, kommt der Prozess nicht in Gang. Meetings werden verschoben, technische Hürden tauchen plötzlich auf, die Stimmung ist schlecht. Der bewusste Grund sind „operative Schwierigkeiten“. Der unbewusste Widerstand könnte aber die Angst sein, den eigenen Expertenstatus zu verlieren, die eingespielte Team-Routine aufzugeben oder die Sorge, den neuen Anforderungen nicht gewachsen zu sein.
Haltung fürs Produktmanagement: Widerstand ist ein wertvolles Signal. Statt mit mehr Druck oder besseren Argumenten zu reagieren, können wir den Raum halten und neugierig werden. Die produktive Frage ist nicht: „Warum seid ihr dagegen?“, sondern: „Wovor genau schützen wir uns? Was würden wir verlieren, wenn wir es anders machen?“ So wird die Angst dahinter sichtbar und wir können gemeinsam Lösungen finden, die diese Bedürfnisse berücksichtigen.
Die Übertragung
Ich lernte, dass die Beziehung zum Therapeuten ein zentraler Teil der Arbeit ist. Wir begegnen Menschen nie neutral, sondern bringen immer unsere ganze Geschichte mit. Das Konzept der Übertragung beschreibt genau diesen Prozess: Wir projizieren unbewusst Gefühle, Erwartungen und Beziehungsmuster aus unserer Vergangenheit auf Menschen in der Gegenwart. Wir reagieren dann nicht auf die reale Person, sondern auf ein „Gespenst“ aus unserer eigenen Biografie. Und das passiert in beide Richtungen.
Beispiel: Ein Stakeholder reagiert auf eine Präsentation extrem misstrauisch, obwohl die Daten solide sind. Es könnte sein, dass ihr ihn unbewusst an einen früheren Mitarbeiter erinnert, der ihn enttäuscht hat. Er überträgt seine alten Gefühle von Misstrauen auf dich. Deine Reaktion darauf (vielleicht fühlst du dich persönlich angegriffen und wirst defensiv) ist die sogenannte Gegenübertragung. So entsteht ein Konflikt, der mit der eigentlichen Sache nichts zu tun hat.
Haltung fürs Produktmanagement: Wenn wir eine ungewöhnlich starke emotionale Reaktion auf einen Kollegen oder Stakeholder bei uns bemerken, können wir innehalten und uns fragen: „An wen aus meiner Vergangenheit erinnert mich diese Person gerade? Welche alte Geschichte wird hier bei mir berührt?“ Dieses Bewusstsein hilft uns, Konflikte zu entpersonalisieren. Wir können aufhören, auf die Übertragung des anderen zu reagieren, und stattdessen bewusst auf die eigentliche Situation eingehen. Vielleicht sogar die Gegenposition direkt einzunehmen.

Mit diesen Konzepten im Hinterkopf veränderte sich meine Wahrnehmung von Verhaltensweisen. Den Eigenen und den Fremden. Was nicht bedeutet, dass ich nun immer entspannt bleibe und jede Situation Schicht für Schicht auseinander nehme. Aber ich empfinde mich zugewandter. Das ist manchmal anstrengend, aber bringt mich Freunden, Kolleginnen und Kunden näher. Es hilft mir Empathie zu entwickeln. Nicht direkt in den Lösungsmodus zu springen.
Ich begleite Situationen und versuche, das Gegenüber zu verstehen. Stelle Fragen, höre zu und halte den Raum. In einer Branche, die sich zu oft auf technische Entwicklungen, betriebswirtschaftliche Dynamiken und den nächsten großen Trend konzentriert. Wir optimieren Prozesse, implementieren Tools und analysieren Daten. Wir teilen Belangloses auf LinkedIn für Reichweite und Bestätigung. Wir beschäftigen uns mit Technologie.
Schaue ich auf meine Therapie, so bin ich überzeugt: wir müssen uns wieder mehr mit Menschen und ihren Verhaltensweisen beschäftigen. Offenheit uns selbst gegenüber und unseren Kolleg:innen. Nachsichtigkeit. Und Neugierde.
Die nächste Irritation, der nächste Konflikt, die nächste unerwartete Reaktion kommen bestimmt. Die Frage ist: Springe ich sofort in den Lösungsmodus? Oder atme ich durch und frage mich: Was passiert hier wirklich? Welches Bedürfnis, welche Angst, welches Muster zeigt sich gerade?
Dieser Perspektivwechsel hat meine Arbeit verändert. Wie sich meine Haltung durch eine systemisch-psychologische Ausbildung verändert, beschreibe ich im nächsten Teil.
Du bist neugierig geworden und möchtest tiefer ins Thema Psychoanalyse eintauchen? Dann mag ich dir den Podcast Rätsel des Unbewussten empfehlen. Oder wir gehen spazieren und quatschen. Das mag ich noch mehr.
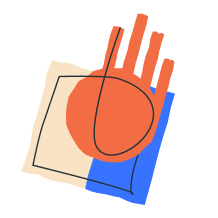
[…] ich über meine Veränderung. Über das Verstehen von Mustern und Anpassen der eigenen Haltung. Psychoanalyse brachte mir Zugewandtheit und Ruhe. Empfinde mich als interessierter. Möchte aber noch besser […]
[…] uns erschöpft. Müde vom Optimieren und Reagieren. Überforderung an so vielen Stellen. Wie kann Psychoanalyse dabei helfen, wieder Stimmigkeit zu finden? Und welche Modelle lassen sich auch im […]